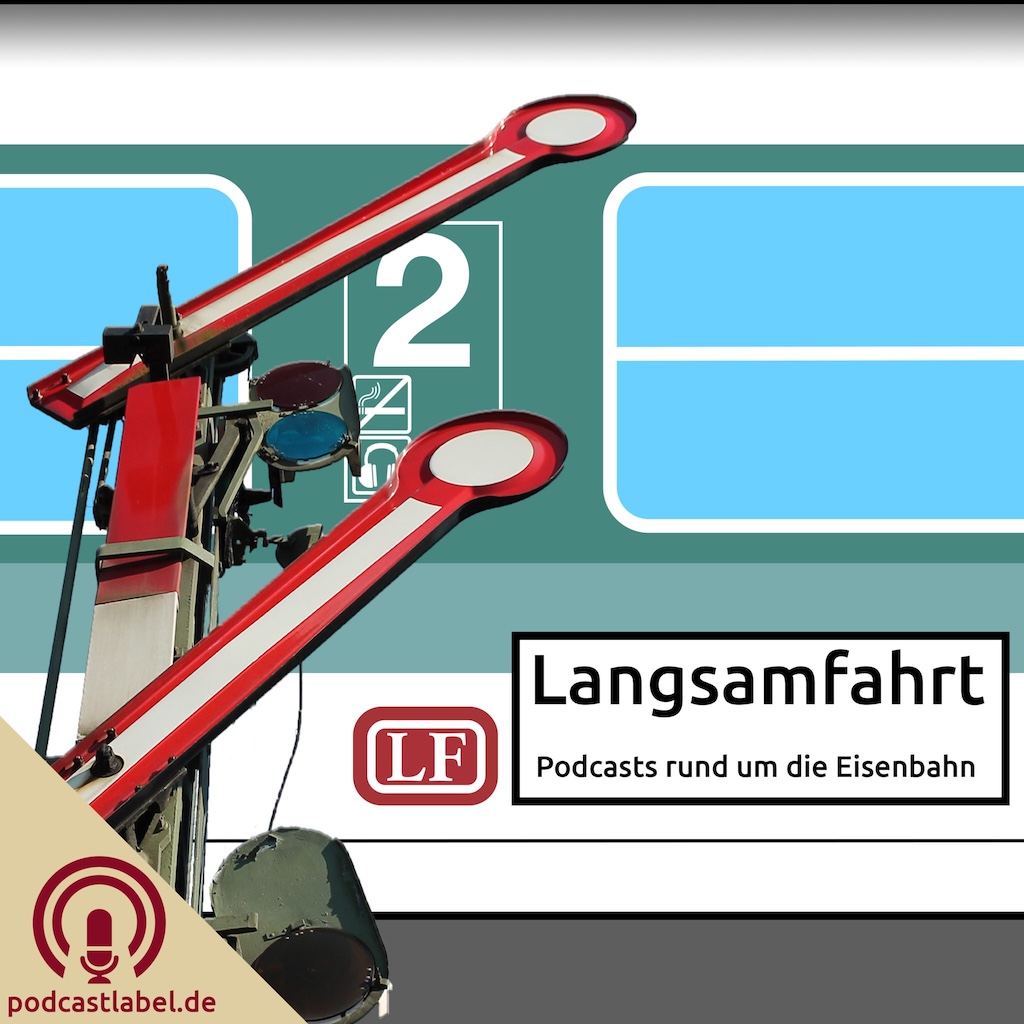12. Januar 2026

Heute: Raumschiff Unerhørt. Studio volans.
Raumschiff Unerhørt ist eigentlich kein Vogel, aber da es sehr viel Zeit mit Herumfliegen verbracht hat, zählen wir es hier zu den Vögeln ehrenhalber.
In Form von Studio A flüchtete dieses – ich nenne es in Ermangelung einer anderen Vokabel mal: Wesen – zum ersten Mal im Frühjahr 2017 aus dem offenen Studiofenster im ersten Stock, während der Frühjahrsputz im Studio-Raum stattfand. Also während des Spinnweben- und Akustikelemente-Wegsaugens.
Auf einmal gab es einen erheblichen Geräuschpegel, und das Mischpult und ein paar andere, damals nicht genau identifizierte, Geräte schwangen sich kollektiv aus dem Fenster und nahmen ein Tauchbad in der Lahn, wo sie auf die Jagd nach Moby Dick gingen.
Sie fanden ihn nicht, wurden wieder eingefangen, trockengelegt und vom Lahnschlamm gereinigt, und machten danach brav ihre Studio-Arbeit weiter – bis zum Frühjahr 2018. Dort passierte das Gleiche noch mal, und zwei Praktikant_innen beim Radio erlitten fast einen Herzanfall.
Seitdem wurde das Studio-Fenster bei RUM nicht mehr geöffnet, um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern. Aber im Gerätezoo rumorte weiterhin ein Freiheitsgeist, der durch nichts zu bremsen war.
Das Radio zog damals in ein Ausweichquartier um, damit das Funkhaus in aller Ruhe saniert werden konnte, und bei diesem Umzug landete das Studio A in einem Kellerverlies, in dem sich auch Ratten, Spinnenläufer, rebellische Videorecorder im Rentnerstress, mit dem Nochmalanhören von RUM-Programm der Jahre 1995-2005 dauergefolterte SSR, und eine schlangenäugige Internet-Funkstrecke tummelten.
Während der Grundreinigung im Sommer (2018) wurden dem Mischpult fatalerweise die Ketten abgenommen, die es vorher im Keller am Boden gebannt hielten, und das Mischpult stellte sich dabei so harmlos und „mich kann kein Prilblümchen trüben“-mäßig an, dass die erneute Fesselung nach der Reinigung einfach vergessen wurde.
Dabei glomm längst der erneuerte Ausbruchwille in seinen irrlichternden VU-Metern.
Zusammen mit anderen sinistren Genossen dieses Rattenkellers heckte das Mischpult, welches mittlerweile den Namen Käpt‘n Kraken angenommen hatte, einen Fluchtplan aus, der nach monatelanger Elektrisierung der Gemüter – durch den Rückumzug Mitte November (2018) in ein Zwischenlager im ersten Stock – schließlich vollkommen unerwartet umgesetzt werden konnte.
Diesmal war aber nicht die Lahn das Ziel, sondern die Sterne lockten!
Das Weltall rief!
Käpt‘n Kraken und Tape Deck der als Vorverstärker vielfach Missbrauchte, auch Yay Yay Yay nach seinem Rückspulgeräusch gerufen, sich selbst aber lieber Kampfdeck oder Käpt’n Ahab nennend, bildeten nach überwundener Überraschung im Dezember 2018 eine Flugzweckgemeinschaft, das heißt, sie schraubten sich auf eine Weise zusammen die dem internationalen TMI Code (Too Much Information) entspricht, griffen sich das Album von Helene Fischer aus dem RUM-Musikarchiv, montierten zum Antrieb hinten an ihre Zweckgemeinschaft die Monitor-Aktivboxen an, und donnerten auf deren 100 Hz-Rechteckwellen-Bums bei voller Leistung auf und davon in den Hyperraum.
Von den RUM-Biolebensformen hatten es gerade eben noch eine Ratte, eine Katze, ein Chamäleon und ein Zwergbär an Bord geschafft, die nun unerwarteterweise den Flug in den Marmota-Nebel der Parallelgalaxie mit antraten, ob sie wollten oder nicht.
Dem Radio entstanden durch diesen Ausbruch von Studio A zwischen Weihnachten und Neujahr erhebliche Straf- und Schadensersatz-Forderungen in Atair-Dollars und anderen exotischen Währungen, welche unseren Finanzverwaltungsmenschen noch heute mit der Umrechnung der Beträge in Euro beschäftigen und danach mit der Frage, ob, und wenn ja, wo dagegen Widerspruch einzulegen sei.
Raumschiff Unerhørt, Studio A, werden unter anderem:
- zu schnell Fliegen,
- grober Unsinn im Hyperraum,
- Krakensex an einer grünen Ampel,
- die Zerstörung des legendären SLOT IN bei Atair durch mutwillige Beschießung mit zwei CDs,
- Abspielen von Helene Fischer in gemafreier Zone,
- Abspielen von Helene Fischer an einer grünen Ampel,
- Verstoß gegen interplanetare Akustikwaffenabkommen,
- ein Fuchsschwanz an der Antenne,
- der Ruf Yay Yay Yay vor 22 Uhr und
- die Entwicklung und Inbetriebnahme eines Antiradar-Joghurtinators
vorgeworfen.
Außerdem existiert eine Zivilklage des Schriftstellers Moby Dick von Cetacea, Galaxie 4711 auf Spiralarm 0815 des Marmota-Nebels, der sich durch die mutwillige Harpunierung seines Buches „1000 Gründe zuhause zu bleiben und nicht auf einen Weltraumtrip zu gehen“, in seinen Persönlichkeitsrechten auf‘s derbste verletzt sieht.
Letzterer Klage geht derzeit mit großem Ernst die Staatsanwaltschaft Heppenheim nach, was nichts Gutes hoffen lässt, weil Heppenheim für seine sehr diplomatischen Beziehungen zum Marmota-Nebel berüchtigt ist.
Fernab dieser eher unerfreulichen Folgen des Weltraum-Ausfluges von Studio A, scheint es der Crew an Bord mittlerweile gelungen zu sein, Käpt‘n Kraken, der vom Zwergbär nur „der Kalamari“ genannt wird, stabil davon zu überzeugen, auf die Erde zurückzukehren und die Sendeleitung als normales Sendestudio bei einem kleinen nichtkommerziellen Lokalradio wieder zu übernehmen.
Der Termin für die Landung von Raumschiff Unerhørt ist ungefähr zu erwarten heute am 15. Januar 2019 gegen 10 Uhr Terrazeit, Berlinzeit, Winterzeit. Wahrscheinlich kracht es also mit seinem Bremsmanöver genau in unsere Wiederholung der Frühschicht hinein.
Wundern Sie sich daher nicht darüber, wenn plötzlich die Frühschicht weg ist; genießen Sie dann stattdessen ein wenig Panikmusikprogramm von unserem SSR-Empfangskomittee, welches eilends eingerichtet wurde um das Geräusch von zerberstenden Fensterscheiben und splitternder Trockenbau-Kabinenwand zu übertönen.
Aus uns noch unbekannten Gründen hat sich Raumschiff Unerhørt nämlich ausbedungen, durch das Studio-Fenster im ersten Stock zu landen.
Wir vermuten, dass das irgendwas mit einem ominösen Schrumpfschlauch und einem mindestens genauso ominösen Paralleluniversum zu tun hat. Wie auch immer:
Gute Landung und Willkommen daheim Raumschiff Unerhørt Studio A!